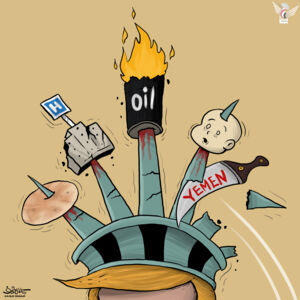Tripolis - Saba:
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie hat die Existenz einer bislang unbekannten menschlichen Abstammungslinie in Afrika enthüllt. Diese geht auf die Zeit zurück, als sich moderne Menschengruppen vor 50.000 Jahren über den Kontinent hinaus auszubreiten begannen.
Ein internationales Forscherteam des Max-Planck-Instituts in Deutschland hat in Zusammenarbeit mit den italienischen Universitäten Florenz und Rom Sapienza die DNA der Überreste zweier Frauen analysiert, die im Tarkori-Felsunterstand im Herzen der libyschen Wüste gefunden wurden.
Diese Überreste stammen aus der Zeit, die geologisch als Afrikanische Feuchtperiode oder Grüne Sahara bekannt ist, als die Region vor 14.500 bis 5.000 Jahren eine blühende Savanne war.
Die Studie zeigt, dass die Sahara – heute als die größte heiße Wüste der Welt bekannt – damals aus riesigen Wasserflächen und üppigen Wäldern bestand und somit ein ideales Umfeld für menschliche Besiedlung und Viehzucht bot. Dieses historische Paradoxon wirft wichtige Fragen über die Fähigkeit des Klimawandels auf, die Landkarte der menschlichen Zivilisationen neu zu gestalten.
Genetische Analysen der entdeckten Überreste brachten eine große wissenschaftliche Überraschung ans Licht: die Existenz einer einzigartigen menschlichen Abstammungslinie in Nordafrika, die etwa 50.000 Jahre lang genetisch von ihren Gegenstücken südlich der Sahara isoliert war. Diese Ergebnisse widerlegen die bisherige Theorie über die Existenz eines genetischen Austauschs zwischen den beiden Regionen während dieses Zeitraums.
Die Studie enthüllte faszinierende Details über die genetische Zusammensetzung der antiken Bevölkerung. Dabei stellte sich heraus, dass die DNA der Tarkori-Frauen einen geringeren Anteil an Neandertaler-Genen enthielt als die DNA von Populationen außerhalb Afrikas. Allerdings war dieser Prozentsatz höher als der in den Populationen südlich der Sahara festgestellte, was auf einen begrenzten Genfluss von außerhalb des afrikanischen Kontinents hindeutet.
Genetischen Analysen zufolge gehören die beiden im Tarkori-Felsen begrabenen Frauen einer einzigartigen nordafrikanischen Linie an, die sich etwa zur gleichen Zeit von den Populationen südlich der Sahara abspaltete, als sich vor etwa 50.000 Jahren die modernen menschlichen Linien aus Afrika auszubreiten begannen. Diese beiden Frauen hatten „enge genetische Verbindungen“ zu Jägern und Sammlern, die vor 15.000 Jahren während der Eiszeit in der Taforalt-Höhle in Marokko lebten, einer sogenannten „Iberomaurus-Kultur“, die der afrikanischen Feuchtperiode vorausging.
Diese Linie ist genetisch von den Linien südlich der Sahara getrennt. Bisher glaubten Archäologen, dass es einen Genfluss zwischen den beiden Regionen gab, doch die neue Studie beweist das Gegenteil. Nordafrika verfügt über seinen eigenen einzigartigen Genpool.
„Diese Ergebnisse widerlegen bisherige Annahmen und enthüllen eine unerwartete genetische Trennung zwischen Nord- und Südsahara“, kommentierte Professor Johannes Krause, Direktor des Max-Planck-Instituts.
„Wir haben wichtige genetische Beweise für eine fortgeschrittene menschliche Zivilisation in der Grünen Wüste gefunden, die sich über Tausende von Jahren isoliert entwickelt hat“, fügte Dr. Nada Salem, die Erstautorin der Studie vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, hinzu.
Professor David Caramelli von der Universität Florenz stellt fest: „Diese Studie beweist, dass moderne genetische Analysetechniken Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen können, die mit traditionellen archäologischen Werkzeugen nicht aufgedeckt werden konnten.“